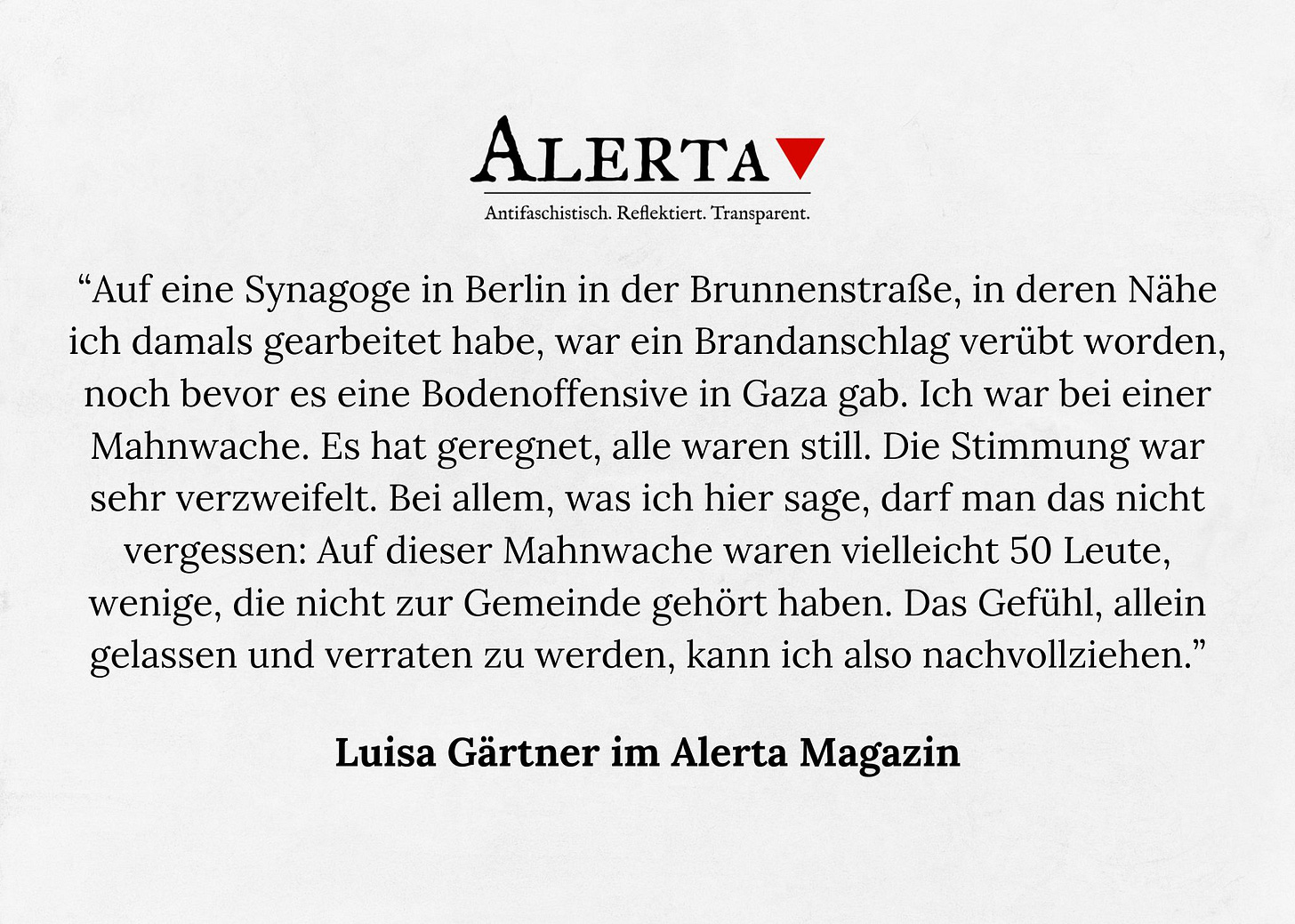Wie wissenschaftlich ist die Antisemitismusforschung in Deutschland? Ein Plädoyer für mehr Transparenz und politische Neutralität.
Seit dem 07. Oktober 2023 steigen die Fälle antisemitischer Vorfälle. Aber was genau ist eigentlich antisemitisch und tut die undifferenzierte Nutzung des Begriffs Betroffenen wirklich einen Gefallen?
Mit dem grausamen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 07. Oktober 2023 hat der Nahost Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht, mit zum Teil verheerenden Folgen für die Menschen in Israel, im Gazastreifen, in der gesamten Region. Und während es für die Menschen dort um Leben und Tod geht, wird sich hier in sicherer Entfernung immer heftiger darüber gestritten, welche Toten man rechtfertigen kann und welche nicht. Unter anderem dieser Empathie Verlust war es, der Luisa Gärtner dazu bewegt hat, ihre Arbeit in einer Forschungsgruppe der Uni Trier zum Thema Antisemitismus niederzulegen. Im Gespräch mit Sabrina Teifel schildert sie ausführlich und differenziert, was aus ihrer Sicht die Probleme der aktuellen Debatten sind.
1. Du bist – bzw. warst, aber dazu kommen wir noch – in einer Forschungsgruppe zum Thema Antisemitismus an der Universität Trier tätig. Hol uns doch einmal ein bisschen ab und erkläre uns kurz, was genau in der Antisemitismusforschung eigentlich gemacht wird?
Tja, das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. In Deutschland gibt es kaum institutionalisierte Antisemitismusforschung, also zum Beispiel als Institut an der Uni, außer zwei größere Institute bzw. Projekte: Das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und größere Projekte an der Uni Passau in der Soziologie. Das sind die zwei großen universitären Forschungszentren, und die streiten sich darüber, wie man israelbezogenen Antisemitismus einordnet, wozu ich nachher komme.
Und dann gibt es noch andere, auf ein positives Bild von Israel bezogene Institute, wie das Tikvah-Institut. Es ist manchmal allein von der Bezeichnung her sehr schwer zu unterscheiden (das ist auch allgemein eine gesellschaftliche und innerakademische Debatte), wie in diesen Instituten Wissenschaft und Aktivismus zusammen gehen und wie viel Aktivismus und Bias in der Wissenschaft noch okay ist. Bei dem Tikvah-Institut zum Beispiel sehe ich das Problem, dass das Tikvah-Institut eine Lobbyorganisation ist, die auch mit der DIG (der deutsch-israelischen Gesellschaft) zusammenarbeitet, es auch für bestimmte proisraelische Forschung finanziert wird und, wie die DIG auch, ins Lobbyregister des deutschen Bundestages eingetragen ist. Ich habe lange überlegt, ob ich das mit der Lobby überhaupt erwähnen soll, aber ich finde, es ist wichtig, zu benennen, wann sich „wissenschaftlich“ nennende Institute Lobbyarbeit machen. Die Stoßrichtung jeder Forschung, jeder Veranstaltung wird ja dadurch bestimmt. Lobbyarbeit beeinflusst in diesem Fall allein schon durch die Finanzierung bestimmter Veranstaltungen die Wissenschaft. Das ist keine Kritik an den Wissenschaftler*innen oder Aktivist*innen per se, die dort Veranstaltungen machen. Es ist aber eine Kritik, die ich am System der Antisemitismusforschung und der Forschung generell formulieren möchte. Und ich finde es ist auch eine Frage der Transparenz, das offen zu kommunizieren.
Zum Thema Lobby will ich noch was Allgemeines sagen: dieses Thema ist momentan auch Teil des Antisemitismusvorwurfs, zumindest des Vorwurfs durch bestimmte Organisationen. Zum Beispiel war eine Begründung für die US-Sanktionen an die UN-Beauftragte für Palästinenser, Francesca Albanese, unter anderem, dass sie gesagt hat, in den USA gibt es eine proisraelische Lobby. Die gibt es, das American Israel Public Affairs Committee ist meines Wissens die größte solche Lobbyorganisation in den USA. Trotzdem wird das Benennen, dass es eben solche Organisationen gibt, von einigen Organisationen und Akteuren als Antisemitismus bezeichnet. Der Grund, warum das mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wird, ist, dass Israel als Kollektivjuden quasi Einflussnahme auf die Weltgeschicke unterstellt werden kann, und wenn damit gemeint ist, dass die Juden so etwas machen oder übermächtig sind, ist das ganz klar Antisemitismus. Aber: Natürlich gibt es gleichzeitig diese Tatsache, dass die eben von mir genannten deutschen Institute im Lobbyregister des Bundestags stehen. Du merkst, wir sind hier schon mitten im Problem. Wenn ich diesen Umstand benenne als Teil meines Problems mit deutscher Antisemitismusforschung, kann ich Antisemitismus damit Vorschub leisten. Gleichzeitig muss ich Fakten benennen, und da die staatliche Finanzierung für unabhängige Forschung kaum vorhanden ist, braucht die Antisemitismusforschung auch diese Institute. Wissenschaftlich im Sinne von freier Forschung und ohne politische Agenda würde ich sie jedoch nicht nennen. Im Lobbyregister steht für das Tikvah-Institut außer der Antisemitismusbekämpfung:
„- Stärkung jüdischen Lebens ( z. B. Feiertagsrecht, Rentengerechtigkeit für jüdische Zuwanderer, Sicherheit etc.)
- Förderung eines fairen und freundschaftlichen Verhältnis zum jüdischen und demokratischen Staat Israel im Sinne der deutschen Staatsräson.
Hierfür entwerfen wir Policy papers, führen Projekte wie Veranstaltungen durch und werben für Gesetzesvorhaben.
Deren Inhalte vermitteln wir an Abgeordnete und Regierungsstellen wie Bundesministerien und Beauftragte.“
Das heißt, das, was ich da lese, hat eigentlich erstmal wenig mit Forschung und Wissenschaft zu, aber viel mit der Aufforderung, das Versprechen, Israel jederzeit zu verteidigen, einzuhalten. Wenn innerhalb von Tagungen eine Studie des Tikvah-Institutes vorgestellt wird, oder das Institut zitiert wird, halte ich das für nicht unbedingt saubere wissenschaftliche Arbeit. Unabhängig vom Inhalt der Studie. Aber es passiert dauernd.
Nach dieser sehr langen Einordnung nun zurück zu deiner Frage:
Ein Großteil der Antisemitismusforschung ist entweder drittmittelfinanziert oder wird auf Professuren betrieben. Nicht alle, die auf Konferenzen Paper vorstellen, haben wirklich zu Antisemitismus geforscht, was ja auch grundsätzlich okay ist - manchmal haben Menschen gute Argumente, kennen sich gut mit kritischer Theorie aus und bringen neue Perspektiven ein. Durch diese Struktur, dass die Institute, die Konferenzen ausschreiben, lobbyfinanziert sind, lässt sich allerdings anzweifeln, ob nicht die Perspektive der ausgewählten Teilnehmenden auf das, was DIG oder Tikvah als “richtige Meinung” sehen, eine große Rolle spielt.
Forschungsgruppen, aktivistische Kollektive oder Institute können natürlich auch, wie in Trier, zunächst mal in studentischer Initiative entstehen. In diesem Fall war das eine Gruppe von Noch-Studis und zwei, die durch die Organisation einer Konferenz eine Lücke schließen wollten, weil es kaum Möglichkeiten für Nachwuchswissenschaftler*innen gab, sich zu vernetzen und ihre Forschung zu präsentieren - das ist ja ein allgemeines Problem, aber in Deutschland besonders krass.
Was wird also gemacht? Es werden Forschungsprojekte gemacht, aber meistens von einer Person. Diese finanziert das Wissenschaftsministerium. Wir mussten sehr für die forschenden Projekte kämpfen. Früher gab es eine Projektlogik, die Output orientiert war, also zum Beispiel wurden unsere Kulturwochen gegen Antisemitismus gefördert, es spielte eine Rolle, wie viele Menschen kommen, wie berühmt die performenden Leute sind, und so weiter. Forschung wurde erst seit 2024 finanziert. Ich weiß nicht, wie viele Forschungsprojekte davon gerade abgeschlossen sind, da ich Ende 2024 ausgestiegen bin. Es gibt z. B. Antisemitismus im Fußball oder bei den Republikanern in Amerika als Thema. Es gibt aber keine Professur, die diese Projekte betreut.
2. Weißt du, ob es da einen Unterschied gibt zwischen der Antisemitismusforschung in Deutschland und der internationalen Forschung zu diesem Thema?
Die einzigen mir bekannten sind zwei schon länger bestehenden (seit den 80ern) große Institute, die sich auch dem Namen nach nur dem Thema verschrieben haben, sind das ZFA in Berlin, was ich eben schon genannt habe, und das Vidaal Sasson International Centre an der hebräischen Universität Jerusalem. Mir sind sonst noch die ADL (Anti-Defamation-League) und das London Centre of Antisemitism bekannt. Es gibt außerdem Tagungen zur Antisemitismusforschung in den nordischen Ländern. Die Antisemitismusforschung an Universitäten muss ja fast immer noch Fächern zugeordnet sein, da gibt es einmal die Soziologie und die Geschichte.
3. Nun gibt es ja unterschiedliche Definitionen von Antisemitismus – gibt es im akademischen Bereich DIE eine Definition, mit der man arbeitet und die offiziell gültig ist?
Nein, gibt es nicht. Ich habe eben schon erwähnt, dass sich Forschende in Passau mit dem ZFA in Berlin streiten, das wurde sogar in der FAZ ausgetragen, deswegen erwähne ich es. Es wird über 2 Definitionen gestritten: Die IHRA und die JDA. Die IHRA ist eine Arbeitsdefinition und listet Beispiele. Mit der IHRA gibt es ein Forschungsproblem, man kann sie dort schlecht anwenden, sie bleibt nämlich sehr offen, vieles KANN Antisemitismus sein. Das ist natürlich irgendwie auch ehrlich. Und es gibt nach Ansicht vieler Menschen, auch von Forschenden, noch ein anderes, zu dem ich gleich komme. Die JDA wurde dann geschrieben, um zu konkretisieren. Sie ist von vielen WissenschaftlerInnen unterschrieben worden, auch jüdischen. Die Befürworter der IHRA werfen der der JDA vor, Antisemitismus Vorschub zu leisten. In der JDA steht, dass Kritik am Handeln der israelischen Regierung, die weder antisemitisch dämonisiert noch Israel als Kollektivjuden sieht, nicht antisemitisch ist (sinngemäß). Sie unterscheidet auch zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Der Punkt, dass sehr viel Kritik an Israel Antisemitismus ist, den die IHRA macht, führt hier zum Streit. Man hat das gesehen, als die LINKE sich auf ihrem Bundesparteitag entschieden hat, sich nach der JDA zu richten. Es wurde in den sozialen Medien, gerade in meiner Bubble, vielfach der Vorwurf laut, die Linke leiste Antisemitismus Vorschub. Ehrlich gesagt, ich glaube das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Die JDA vermittelt ein gutes Bild zu Antisemitismus. Sie mag aber auch die Möglichkeit bieten, nicht konsequent genug gegen israelbezogenen Antisemitismus zu sein. Aber dieser ist eben Gegenstand tagespolitischer Debatten. Die gegenwärtige israelische Regierung vertritt die IHRA. Und wie eben schon angeklungen ist, ist die Antisemitismusforschung bzw. sind große Teile davon, nicht entkoppelt von der Solidarität zu Israel und auch von Lobbyorganisationen und Geldgebern, die sich auch im jetzigen Konflikt sehr dafür einsetzen, ein positives Israelbild zu schaffen. Ich glaube persönlich, dass es dieser Umstand sehr schwer macht, sich wissenschaftlich ungetrübt mit dieser Frage nach der Definition auseinanderzusetzen.
Das Definitionsproblem gab es aber vorher schon, und zwar auch aus dem Grund, dass Antisemitismus so alt ist - über 2000 Jahre. Er hat seine Motive und sprachlichen Muster geändert, nicht aber seine Funktion. Deswegen, weil er so adaptiv ist, aber auch so kontinuierlich, lässt er sich schwer definieren. Man könnte ja sagen „warum denn, es geht doch immer um Hass gegen Juden?“. Aber es geht um Vorwürfe gegen und Bilder von Juden, die sie ja nicht beschreiben, also eine Fremdzuschreibung. Deswegen ist es so ein Kreuz mit dem israelbezogenen Antisemitismus. Auch wenn in Israel so viele verschiedene Menschen leben und bei weitem nicht alle Juden sind, kann es israelbezogenen Antisemitismus geben, der “die Juden” und Israel gleichsetzt. Wenn Israel z. B. die Weltgeschicke lenken soll oder die Finanzmärkte, dann bedient sich diese Idee älteren Narrativen gegenüber Juden.
Schwierig wird es jetzt beim Kindermörder-Vorwurf. Proisraelischer Aktivismus wirft propalästinensischen DemonstrantInnen zum Beispiel vor, dass “Kindermörder Israel” eine Adaption der alten Ritualmordlegende gegen Jüdinnen und Juden ist. Das ist Antisemitismus. Zugleich gibt es die tagespolitische Lage in Gaza. Dort lebt eine überdurchschnittlich Junge Bevölkerung, mindestens 15.000 Minderjährige wurden bis heute getötet. Der Vorwurf ist also Teil einer tagespolitischen Sache, nicht einfach etwas, das von der Realität entkoppelt ist. Die IDF tötet zu viele Kinder. Der Vorwurf, Kinder töten zu wollen, ist in der Geschichte antisemitisch und heute kann er das auch sein. Man sollte aber nicht Kritik mit dem Antisemitismusvorwurf abwehren, die sich gegen reales Töten wendet. Damit macht sich die proisraelische Antisemitismusforschung unglaubwürdig. Und es ist inhuman, menschenfeindlich, eine Katastrophe, Menschenleben durch so ein Argument zu entwerten. Kinder werden in allen Hilfskampagnen nach vorne gestellt, weil sie die Unschuld demonstrieren. Israelische Rechte behaupten, alle Kinder in Gaza würden ohnehin zu Monstern. Wenn man sagt, es sei Antisemitismus, das Kindertöten durch die IDF zu kritisieren, spielt man diesen Leuten den Ball zu und hilft ihrer Argumentation. Und ich frage mich, wie viel Antisemitismus das Vorschub leistet. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn wir Kritik an israelischer Politik als antisemitisch labeln und Expert*innen sie nicht selbst leisten, einordnen, Menschen abholen, die keine sogenannten “Freunde Israels” sind, leisten wir keinen Beitrag gegen Antisemitismus. Die Räume für Diskurs, ein Hinterfragen und auch eine grundsätzliche Neutralität im Sinne der absoluten Prämisse, dass der Einsatz gegen jede Form von Diskriminierung gleich wichtig ist, sind nicht offen genug geblieben.
Das sehe ich zum Beispiel bei Initiativen, die im Feminismus für die Anerkennung der Vergewaltigungen durch die Hamas eintreten. Nach dem 07. Oktober waren sehr viele intersektional feministische Kollektive für meinen Geschmack zu langsam damit, die Vergewaltigungen zu verurteilen. Ich denke mal, weil insbesondere internationaler Feminismus stark eine postkoloniale Perspektive vertritt und der 07. Oktober da eingebunden wurde. Für welche unterdrückte Gruppe soll ich mich einsetzen? Diese Frage ist, finde ich, im Feminismus lange nicht gestellt worden. „Believe all women!“ war das credo, und am 07. Oktober fiel es Initiativen schwer, sich so für israelische Frauen einzusetzen, wie sie es für andere vergewaltigte Personen tun. Das hat zurecht für Frust bei israelischen Frauen gesorgt. Was aber daraus entstanden ist, kann man ganz schön in den Kommentarspalten auf „feminist“ sehen: die „Believe israeli women“-Initiativen setzen sich NUR dafür ein, dass israelischen Frauen geglaubt wird. Die DIG zum Beispiel greift das auf. Ich habe mal einen Call for Papers darüber für eine Konferenz beantwortet und wurde angenommen, aber ich hätte eigentlich gerne diesen polarisierten Diskurs aufgegriffen, in dem auch Israelinnen bzw. Kommentator*innen, die sich als solche ausgaben, Palästinenserinnen abgesprochen haben, vergewaltigt worden zu sein, Probleme mit der Versorgung der Periode zu haben, dass die Fehlgeburtenrate sehr hoch sei usw.. Ich habe dann gemerkt, dass die Veranstaltung und die anderen Beiträge nur auf die Perspektive der israelischen Frauen bezogen sind und ich lieber eigentlich nicht teilnehmen würde. Dann kam noch ein privater Krankheitsfall dazu und ich war erleichtert, absagen zu müssen.
4. Der 07.10.2023 war ein Wendepunkt für jüdisches Leben in Israel und weltweit. Wie waren die unmittelbaren Reaktionen in deinem akademischen Umfeld auf den Angriff der Hamas am 07. Oktober 2023?
Ich beschreibe mal meine ersten Tage danach: Auf eine Synagoge in Berlin in der Brunnenstraße, in deren Nähe ich damals gearbeitet habe, war ein Brandanschlag verübt worden, noch bevor es eine Bodenoffensive in Gaza gab. Ich war bei einer Mahnwache. Es hat geregnet, alle waren still. Die Stimmung war sehr verzweifelt. Bei allem, was ich hier sage, darf man das nicht vergessen: Auf dieser Mahnwache waren vielleicht 50 Leute, wenige, die nicht zur Gemeinde gehört haben. Das Gefühl, allein gelassen und verraten zu werden, kann ich total nachvollziehen.
Es gab also allgemein einen großen Mangel an Solidarität und dann eben im Gegensatz dazu aus meiner Bubble heraus sehr viel Solidarität. Auch Wut. Und es hat ein etwas selbstüberhöhter Gedanke meiner Ansicht nach meine Bubble bestimmt, nämlich, dass das eingetreten ist, was man qua seiner Forschung und Vernetzung prophezeit hat: Der antisemitische Krieg findet statt. Die Hamas hat natürlich in die Kiste der antisemitischen Zuschreibungen für den politischen Kampf gegriffen. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen mal eine pädagogische Handreichung zur Hamas erstellt. Bei der Bearbeitung der Charta der Hamas wurde mir sehr klar, dass sie religiöse Begründungen enthält, die zum Töten von Juden aufrufen, dass sie klar antisemitisch sind, egal, nach welcher Definition. Daneben gibt es aber auch eine tagesaktuelle, politische Situation, wie z. B. eine Unterdrückung in den besetzten Gebieten. Es ist zu einfach, alles, was im Nahostkonflikt passiert, mit purem, von politischen Zielen losgelöstem Vernichtungsantisemitismus zu erklären, denke ich heute. Bei der Zustimmung für die Hamas spielen selbstverständlich auch die Lebensbedingungen der PalästinenserInnen eine Rolle. Und die Politik Israels spielt für Radikalisierungsprozesse eine Rolle.
Dazu muss ich sagen, dass ich vor ein paar Jahren noch viele Informationen zu Israels Politik mit Gaza und dem Westjordanland schon durch die Brille gelesen habe, dass Israel, wie immer betont wird, die einzige Demokratie im Nahen Osten ist, ein tolles Land, notwendig für das jüdische Volk, bedroht von überall. Damit will ich nicht sagen, dass das gelogen ist. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann belegt aber in seinen Büchern an Studien, wie viele rechtsreligiöse und ultraorthodoxe Israelis die Demokratie gar nicht so sehr wollten. Ich persönlich finde, es wird viel zu wenig darüber geredet, wie Zionismus verstanden wird im aktuellen Diskurs von Zionist*innen: Als Verteidigung der Demokratie in Israel, in Herzls Sinn einem Israel in dem alle, unabhängig davon, ob sie jüdisch sind oder nicht, die gleichen Rechte haben. Oder als Zionismus, der Jüdinnen und Juden vorrangig und absolut in Israel alle Rechte einräumt. Es gibt ja auch die Eretz Israel Ideologie, also die eines Großisrael, die sich auch als eine Form von Zionismus versteht. Dieses Gespräch, was man davon vertreten kann und was nicht, wovon muss man sich abgrenzen, was sollte man kritisieren, müssen Akteur*innen der Forschung führen, auch öffentlich. Ich habe die Justizreform von Netanjahu, seiner Partei und seinen Koalitionspartnern, zunächst anders als heute, nicht als Versuch verstanden, die Demokratie auszuhöhlen, um sich eigene Vorteile zu verschaffen. LGBTQ ist ebenfalls immer ein großes Thema dieser Argumentation. Ich konnte nicht sehen, wie viel Homophobie durch den starken Rechtsruck von Regierungsmitgliedern ausgeht. Es wurde im schwarz-weiß Schema argumentiert: Das gute Israel mit seinen LGBTQ-Rechten, das schlechte Gaza. Es ist aber ein Spektrum. Ich habe bei Kritik die israelischen Linken angebracht, denn das waren die Bewohner*innen der Kibuzzim. Das waren die Massakrierten, die sich vorher für Frieden eingesetzt haben. Aber sie bestimmen den israelischen Diskurs heute kaum. Zu diesem Thema lohnt es sich, Moshe Zimmermann zu lesen.
Also, der 7. Oktober war eine Zäsur.
Danach hat sich viel verändert, jemand sagte, es sei ein Ausnahmezustand und das stimmt. Wir haben viel mehr mit jüdischen Gemeinden und Organisationen wie der DIG und der WerteUnion zu tun gehabt. Es gab, wie oft, wenn es Krisen gibt, auf einmal Leute, die “mitgemischt” haben in unserem akademischen Kontext, die mir viel zu konservativ (wie die DIG), teils auch rassistisch gegen “Araber” oder viele auch philosemitisch, das heißt verliebt in die eigene Vorstellung von Juden oder das “gelobte Land” Israel waren. Das ist deshalb problematisch, weil ja auch hier ein Bild auf Jüdinnen und Juden projiziert wird, das in die eigene Agenda passt, nicht in die Realität. Wenn Jüdinnen und Juden, die antizionistisch sind, und die gibt es, als “unloyale” Jüd:innen oder sogar als “Kronzeugen antisemitischer Narrative” bezeichnet werden, dann passt das, wie sie ihr Jüdischsein definieren, nicht ins Bild des Sprechenden, und wie bei anderen Diskriminierungsformen werden sie auch wieder fremddefiniert.
Ich habe mich irgendwann gefragt: Did I sign up for this? Der Zweck vieler Veranstaltungen und Konferenzen schien darin zu bestehen, zu bestätigen, dass Israel das Richtige tut. Ich stellte mir die Grundsatzfrage: Wenn Israel kein Kollektivjude ist (das ist Antisemitismus), warum muss ich dann in allem, was ich gegen Antisemitismus tue, immer tagespolitisches Handeln der rechten israelischen Regierung verteidigen? Warum müssen wir immer Demos organisieren und Israelfahnen schwenken? Ich fand, der Anspruch wurde gestellt, proisraelische Aktivistin zu sein statt Wissenschaftlerin. Als Israel 2024 Raketen nach Iran warf, hatte ich kein Interesse daran meine Gedanken zu äußern, nämlich dass ich in dem Moment dachte, dass ein iranischer Gegenschlag ja nun klar auch als Reaktion aufgefasst werden wird, dass es wieder darum gehen wird “wer angefangen hat” und dass ich wünschte, das Militär hätte Iran nicht angegriffen. Einmal fragte eine iranische Schülerin mich, warum Israel eine Atombombe haben dürfe und das nicht zugeben müsse, schließlich seien Atombomben grundsätzlich schlecht. Ich hätte antworten können, dass Israel sich verteidigen muss und bedroht ist, aber fand das irgendwie eine unbefriedigende Antwort, weil sie natürlich die Prämisse enthält, dass Israel etwas dürfen muss, was ich sonst ablehne, um sich zu verteidigen. Es gab einfach damals schon nach meinem Empfinden Tabus. Alle um mich herum waren sich einig, dass es richtig ist, Raketen auf den Iran zu werfen, weil er Israel bedroht, bzw. ich habe keine andere Meinung dazu gehört. Die DIG (die deutsch-israelische Gesellschaft) hat durch ihren Vorsitzenden Volker Beck sogar explizit dazu gratuliert. Wenn ich Zweifel äußerte, wurde mir gesagt, “du kannst das nicht einordnen, du bist kein Militärexperte”. So war das auch mit Gaza und der Einordnung propalästinensischer Demos. Ich sehe den Antisemitismus auf den Demos und kann ihn benennen. Ich kann die Sache, dass Palästinenser*innen Menschenrechte haben und diese nicht gewahrt werden, aber nicht als Antisemitismus labeln. Das Problem, dass das passiert ist, ist m. E. nach durch diese absurde Situation entstanden, dass sich die AS-Forschung in meiner Bubble eben als proisraelische Lobby (hart gesagt) sieht. Es gab und gibt genug Antisemitismus, den man prävenieren muss! Auch israelbezogener. So hat es Moshe Zimmermann mal formuliert. Stattdessen werden IDF-Aussagen nachgeplappert, ohne sie zu Hinterfragen.
5. Israel geht seit dem Angriff militärisch gegen die Hamas vor und wird für sein Vorgehen zunehmend international kritisiert. In Deutschland hagelt es dafür sehr schnell Antisemitismusvorwürfe. Wie war/ist das in deinem akademischen Umfeld?
In meinem Umfeld, und das war ein ganz großes Problem für mich, gab es keine Diskussion darüber, an die ich mich erinnern kann, in der ernsthaft das gesamte Kriegshandeln in Frage gestellt wurde. Israels militärische Reaktion auf den 07.10. zu kritisieren und sie so zu kritisieren, dass man sie ernsthaft in Frage stellt und auch die israelische Politik als menschenfeindlich und inhuman sieht, wurde an dem Punkt als antisemitisch bewertet, oder zumindest in den meisten Fällen. Ich habe das eben schon bei den Kindermörder-Vorwürfen gesagt, es gibt viele Argumente, warum man dies oder jenes als Antisemitismus auslegen kann. Aber: Dass zu viele Kinder durch die israelische Armee sterben, ist ein tagesaktuelles politisches Problem. Es gab im beruflichen Kontext viele negative Aussagen zu den Initiativen, die beiden Seiten empathisch gegenüberstehen, wie: “die meisten Standing-Together-Initiativen sind halt dumm”. Wir hatten vorher Kontakt zum ehemaligen israelischen Militärsprecher, Ayre Sharuz Shalicar. Er ist rechts und immer noch ein Fan der israelischen Armee. Kritik an Leuten wie ihm gab es kaum. Ich persönlich hätte es befürwortet, mich von solchen Leuten öffentlich zu distanzieren.
Ich habe etwa seit Februar 2024, als für mich klar war, die Rechte bestimmte gerade, was von der IDF in Israel und Gaza und im Westjordanland gemacht wird und ich plappere unbewusst ihre Narrative nach, versucht, ein bisschen verbal zu beeinflussen, mit wem ich kooperieren will, wer mir inhuman erscheint etc. Dann habe ich versucht, nur noch mein Forschungsprojekt (es ging um die Marginalisierung weiblicher jüdischer Widerstandskämpferinnen) allein voranzutreiben. Meine Initiative hat sich geschlossen mehr bei Demos für Israel und bei den genannten Organisationen engagiert. Das konnte ich nicht. Ich hielt es auch für spaltend. Ich habe versucht meine Perspektive darzustellen: Wir holen niemanden ab, wenn wir in der Öffentlichkeit pro-IDF auftreten, keine Abwägung und keine Gegenargumente zulassen und nicht ins Gespräch kommen können mit Menschen, die sich ja oft aus guten Gründen für Menschen in Gaza einsetzen. Vor allem verbessern wir so auch nicht die Lage von Jüdinnen und Juden. Wir treiben die Menschen von uns weg, die vielleicht neben einem Hamas-Dreieck demonstriert haben, und genau die müssen wir ganz dringend erreichen. Die Gangart in meinem Umfeld war aber eher “klare Kante” gegen alle, die sich irgendwie propalästinensisch gesehen haben. Ich dachte, das ist falsch. Und ich dachte auch, wir verschlimmern die Situation für die von Antisemitismus Betroffenen.
6. Was war für dich persönlich der Punkt, an dem du ausgestiegen bist? Wie haben deine Kolleg•innen und Vorgesetzten diese Entscheidung aufgenommen?
Da war dann natürlich auch viel Zwischenmenschliches im Argen, und das war es auch vorher schon, auch aus anderen Gründen, die ich zum Beispiel in der Prekarität von Nachwuchswissenschaft, psychischer Belastung durch diese Arbeit, Überarbeitung und der grundsätzlichen Schwierigkeit, eine so wichtige Prävention machen zu wollen durch Wissenschaft, aber nicht zu wissen wie, sehe.
Diese Art der Wissenschaft stellt nach meiner Erfahrung die Anforderung: Entweder Du hustlest dich ich einen Burn-Out oder Du machst Deinen Abschluss nicht, weil Du 30-40 Stunden mit einer 10-Stunden-Hiwi-Stelle beschäftigt bist usw.
Ich glaube, es hat niemanden gewundert, dass ich aufhöre. Es gab vorher auch Gespräche. Ich glaube auch nicht, dass es jemanden gestört hat. Von mir unabhängig finde ich es aber nicht gut, dass sich durch das Weggehen von Leuten wie mir „Kerngruppen” bilden, die scheinbar keinen äußeren Einfluss in Form von Perspektivwechseln zulassen.
7. In der Debatte werden aktuell auch immer wieder Institutionen, die Antisemitismusforschung betreiben, kritisiert, wie z. B. RIAS oder die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ordne uns das doch mal ein, worum geht es da genau? Ist die Kritik deiner Meinung nach berechtigt?
Also: ich finde einseitige Initiativen grundsätzlich problematisch, wenn es wie in diesem Konflikt zwei potentielle Opfer- und gleichzeitig Tätergruppen gibt. RIAS und die Amadeo-Antonio-Stiftung verurteilen Antisemitismus sehr scharf, und es gibt auch Fälle, bei denen ich sagen würde, da kann man das in Zweifel ziehen. Die Daten von RIAS wurden vor Kurzem in einem TAZ-Artikel kritisiert, Moshe Zimmermann wurde von RIAS Antisemitismus und Erinnerungsabwehr vorgeworfen, weil er in einer Rede sagte, „Nie wieder!“ gelte auch für Israel. Es ist sehr schlecht für das Renommee der Antisemitismusforschung und ihre wahrgenommene Wissenschaftlichkeit, wenn so etwas passiert, und es fällt leider auf den ganzen Bereich zurück. Es gibt sehr saubere und kluge Antisemitismusforschung, die dadurch entwertet wird, wenn der ganzen Disziplin der Ruf vorauseilt, das seien Demo-Redner*innen mit Israelfahnen, die im schlimmsten Fall propagandistisch unterwegs sind. Deswegen würde ich das Ganze als Teil einer gesellschaftlichen Polarisierung einordnen, vor der man sich nicht, wie ich es von wissenschaftlichen Instituten und Personen erwarten würde, deutlich abgegrenzt hat. Die Grenzen von Wissenschaft und Aktivismus scheinen dann eben nach außen kaum vorhanden. Damit geht auch einher, dass Fallzahlen zu Antisemitismus daraufhin sehr leicht in Zweifel gezogen werden können.
Wenn ich es scharf formulieren würde, würde ich sagen: Mit bestimmten Vorgehensweisen, ohne alles Mögliche zu Antisemitismus zu erklären, was mit Israel zu tun hat, befördert man den Antisemitismus vielleicht sogar. Und dass Netanjahu den Vorwurf strategisch nutzt, befördert den Antisemitismus auf jeden Fall. Die reale Bedrohung für Jüdinnen und Juden wird im schlimmsten Fall unglaubwürdig. Ich nenne mal ein Beispiel:
In Amsterdam kam es zu Gewalt gegen Fußballspieler des Vereins Maccabi Tel Aviv. Fans dieses Vereins hatten vorher “Tod den Arabern” skandiert und “ich hoffe die IDF killt euch alle”. Die Israelis wurden als “Kanker Joden” (verkrebste Juden) bezeichnet. Hier kam es also zu Antisemitismus und Rassismus. Es gab gewaltbereite Schuldige auf beiden Seiten.
Die propalästinensische Seite teilte Videos von Angriffen der Israel-Fans auf Leute, die sie als Araber lasen, die proisraelische Videos der Angriffe, die auf Maccabi-Fans geschahen. Einzig die Standing-Together-Initiative veröffentlichte ein Statement dazu, dass diese Nacht beides war, rassistisch UND antisemitisch. Es gab eine Kundgebung, zu der ich nicht gegangen bin, obwohl ich Solidarität mit Jüdinnen und Juden zeigen wollte. Der Grund war, dass auf dieser Kundgebung der Angriff auf die Maccabi-Assoziierten als Pogrom bezeichnet wurde. Ich fand das geschichtsvergessen, um ehrlich zu sein.
Zurück zu RIAS und Amadeo Antonio: In solchen Fällen wie im Beispiel kritisieren sie die Gewalt gegen Maccabi Fans als grundsätzlich antisemitisch. Gewalt durch die Maccabi Fans thematisiert man an dieser Stelle nicht. Das gilt auch für Siedlergewalt. Dadurch spalten diese Organisationen so. Weder Free Palestine an den Unis noch die Proisraelischen Gegendemos, Statements und Organisationen bilden das gesamte Geschehene ab. Sie klammern aus. Das ist nicht seriös.
8. Mit dem Angriff Israels auf den Iran ist die Lage im Nahen Osten noch ein ganzes Stück weiter eskaliert – wie hat das die Debatte beeinflusst?
Mit diesem Angriff wollte, so sehen das viele Netanjahu-kritische Israelis und viele internationale Journalisten, der Premier sich als „Mister Security“ aufspielen, und es hat funktioniert. Die tatsächliche Bedrohung durch den Iran für Israel existiert gleichzeitig.
Ich gehe mit der Einordnung, dass dieser Angriff gezeigt hat, wie wenig eigentlich das Völkerrecht gilt und dass es eine sprachliche und in eine sich in den Narrativen um diesen Angriff zeigende Verrohung und Militarisierung gibt, die man auch schon in Bezug auf Gaza beobachten konnte: Es ist wieder en vogue, mit Bomben Frieden bringen zu wollen. Es ist in weiten Teilen akzeptiert und letztlich hat das Merz mit seiner Drecksarbeit-Aussage auch bestätigt. Und ich denke, dass der Iran eine große Bedrohung für Minderheiten und Frauen im eigenen Land ist, dass aber die Behauptung, israelische Angriffe würden diese Minderheiten verteidigen, bodenlos ist. Bodenlos, weil sehr viele Iranerinnen davor gewarnt haben, dass bei jedem Angriff die Bevölkerung mehr in Gefahr ist. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen, weil mir da die Expertise fehlt.
Für diejenigen unter euch, die sich noch intensiver mit den unterschiedlichen Perspektiven von Menschen aus der Region befassen möchten, haben wir hier noch zwei Buchempfehlungen, die beide jeweils noch vor dem 07. Oktober 2023 erschienen sind, die aber an Aktualität nichts verloren haben:
Das Buch „Frenemies: Antisemitismus, Rassismus und ihre Kritiker*innen“ aus dem Verbrecher Verlag, in dem die unterschiedlichsten Stimmen aus Wissenschaft, Bildung und Aktivismus auf Fragen eingehen wie „Ist BDS antisemitisch?“ oder „Was unterscheidet Antisemitismus und Rassismus?“
und das Buch „Israel – was geht mich das an?“, erschienen in der edition mena-watch, welches ebenfalls sehr unterschiedlichen Stimmen von Menschen einfängt, deren Leben auf irgendeine Art mit Israel verwoben ist.